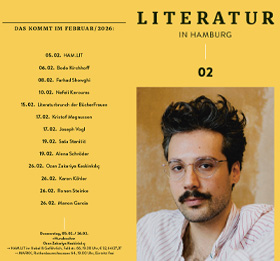Anja Kampmanns »Die Wut ist ein heller Stern«
Kein Ort mehr, um zu bleiben

Hedda, eine junge Artistin und Akrobatin, die sich auch Edda Récord oder Rita nennt, wenn die Umstände es erfordern, hat es aus äußerst prekären Verhältnissen zu einer Hauptattraktion im Alkazar gebracht. Das 1926 von Arthur Wittkowski auf der Reeperbahn eröffnete Varieté ist berühmt für seine freizügigen Shows und eine Bühne mit modernster Technik: Hedda turnt dort in einer »tropischen Nacht« am Seil gefährlich nahe über den »kühl glänzenden Mäulern« der beiden Kaimane Eddy und Fred, die direkt unter ihr platziert sind. Zum Auftakt des Romans erzählt sie davon, wie sie mit Henry, dem Gefährten und Assistenten von Arthur, auf »roten Pumps« nach »Klein Moskau« unterwegs ist, so wurde das Hamburger Gängeviertel damals genannt, in dem sie aufgewachsen ist. Sie rekrutieren dort einen Jungen als Rattenfänger, weil der Schlachthof, seit die Nationalsozialisten das Regiment übernommen haben, kein Fleisch mehr für die Kaimane an das Alkazar liefert. Jetzt sollen sie täglich mit Ratten gefüttert werden, damit sie nicht nach Hedda schnappen: »Frisch müssen sie sein. Die solln nich an soner Ratte verrecken, sagt er. Kein Gift, dass das klar ist.«
Mit der skurrilen Geschichte öffnet Anja Kampmann das Fenster in die Zeit des großen Umbruchs von 1933 bis 1937. In kurzen Episoden, die mal als Tagebuchschnipsel aus nur wenigen Sätzen bestehen, dann wieder aus längeren Passagen, entsteht nach und nach ein Panorama über das Leben und die Stimmung im Milieu auf dem Kiez, unter den Hafenarbeitern, aber auch in den vornehmeren Kreisen der Stadtgesellschaft. Viele der Ereignisse und Personen, von denen erzählt wird, sind bis in Details historisch verbürgt. Arthur, der Impresario und Besitzer des Alkazar, gerät 1933 durch Verleumdungen und Schikanen unter Druck und muss bald dem Nazi Georg Leopold als »Betriebsführer« weichen. Der benennt das Alkazar in Allotria um und lässt die Tänzerinnen fortan im Dirndl auftreten. Kuddel, der Boxer und Mädchenschwarm Heddas, ist Karl Johann August Hacker, eine zentrale Gestalt des Hamburger Arbeitersports, er wurde 1933 im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ermordet. Andere Figuren bleiben namenlos, so wie der Trompeter, der wegen seiner nicht-arischen Abstammung nicht mehr im Alkazar auftreten darf.
Das besondere Kunststück von Anja Kampmanns Roman ist jedoch nicht die meisterhafte Verknüpfung des historischen Zeitpanoramas mit einem individuellen Schicksal, sondern die Erzählstimme Heddas. Durch sie gelingt es, fast schon brennend nah an die Geschehnisse heranzuzoomen. Hedda erzählt in der 1. Person, wechselt aber auch immer wieder in die 3. Person, etwa wenn sie sich als »Rita« bei einem älteren Herrn einhakt, den sie den »Grauen« nennt. Der höchst kultivierte ehemalige Kolonialoffizier, für den die Nazis nur »Pöbel« sind, residiert mit »Trophäen aus Südwest« in einer vornehmen Villa an der Außenalster und klimpert auf einem hundertjährigen Klavier. Hedda hält er sich als Geliebte auf Abruf, obwohl sich »bei ihm nur die Rita auf dem Bett fläzt«. Für Hedda und ihren kleinen Bruder Pauli, der durch ein Handicap mehr und mehr in den Fokus der Behörden gerät und in ein Heim abgeschoben werden soll, ist der »Graue« ein Glücksfall, auch wenn es allenfalls ein Taschengeld ist, mit dem er sie unterstützt.
Doch auch der »Graue« kann nicht verhindern, dass »der Keiler«, der im Roman als Inkarnation der Bedrohung durch das unmelische System auftritt, das bald alle Lebensbereiche durchdringt, ihr immer näherkommt. Für ein »leichtes Mädchen« wie sie gibt es in der schönen neuen Welt des Nationalsozialismus keinen Platz. Nur, wohin könnte sie gehen, an wen sich wenden? Kann ihr Bruder, der als Harpunenschmied auf dem neuen Walfangschiff anheuert, das bei Blohm & Voß gebaut wird, ihr tatsächlich eine Schiffspassage auf der Hansa besorgen, die jeden Donnerstag Richtung Amerika ablegt? Am Ende fehlt Hedda die Kraft für große Träume, aber es treibt sie etwas um, das groß und größer wurde und ihre Geschichte von Beginn an auszeichnet, es ist »eine Wut, die stark und hell ist«. Anja Kampmann gibt dieser Wut mit ihrem Roman in einem furiosen Textteppich eine unüberhörbare Stimme, die einmalig und ein Ereignis in der deutschen Gegenwartsliteratur ist. Und den Frauen auf dem Kiez schenkt sie ein leuchtendes Denkmal, das man auch als Kommentar zu den politisch-gesellschaftlichen Konflikten der Gegenwart lesen kann.
Anja Kampmann, »Die Wut ist ein heller Stern« (Hanser), € 28,–
29.09.2025 | Jürgen Abel